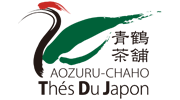Die Teesorten
In eine so weite Welt wie die des japanischen Tees einzutreten, mag auf den ersten Blick etwas schwierig erscheinen. Nur allzu leicht kann man sich von den zahlreichen Teesorten, den manchmal willkürlichen Artikel-Bezeichnungen einiger Anbieter usw. ein wenig überwältigt fühlen, so dass man nicht weiß, wo man anfangen soll. Auf diesen folgenden Seiten möchten wir Ihnen gerne deshalb die notwendigen Erklärungen geben, um Ihnen eine Orientierung zu erleichtern und wir beginnen hier mit einem Leitfaden zu den verschiedenen japanischen Teesorten (dabei erwähne ich in diesem Rahmen ausschließlich Tees, die aus den Blättern der Teepflanze Camellia sinensis hergestellt werden, und nicht die anderen japanischen Aufgussarten wie Mugi-cha oder Soba-cha).
Was ist japanischer Tee?
Der in Japan hergestellte Tee besteht zu 99% aus grünem Tee, was bedeutet, dass die Blätter nach der Ernte nicht oxidiert werden. Im Gegensatz dazu werden beim Schwarz- und Oolong-Tee die Teeblätter einem Oxidationsprozess (meist fälschlicherweise als Fermentation bezeichnet) unterzogen. Um die Enzyme, die für die Oxidation der Teeblätter verantwortlich sind, zu stoppen, müssen die Blätter nach der Ernte erhitzt werden. Die weltweit gängigste Methode besteht in einer Art Röstung, d.h. die Blätter werden direkt im Kontakt mit einer heißen Oberfläche erhitzt. Aber es gibt auch andere Methoden, so können die Blätter gekocht (heutzutage sehr selten) oder gedämpft werden.
In Japan ist diese letztgenannte Dämpfungsmethode am wichtigsten, denn fast alle japanischen Grüntees werden gedämpft, sei es Sencha ebenso wie Gyokuro, Kabuse-cha, Tamaryokucha und sogar Matcha. Nur Kama-iri cha, eine sehr kleine Minorität, wird einer direkten Erhitzung unterzogen, um so die Oxidation zu stoppen.
Prinzipiell hat das Dämpfen der Blätter den Vorteil, dass es sehr schnell und effizient ist, denn sobald der Wasserdampf auf die Blätter trifft, kondensiert er zu flüssigem Wasser, ein Prozess, bei dem viel latente Wärme frei wird, was die Enzymaktivität augenblicklich stoppt.
Bis hierhin kann man also festhalten, dass ein japanischer Tee typischerweise ein gedämpfter Grüntee ist.
Ferner lässt sich sagen, wenn man die ganze Geschichte des Tees in Japan bis ins 8. Jahrhundert zurückverfolgt, dass seine Entwicklung, zu dem wie wir ihn heute kennen, noch relativ jung ist. Dieser Prozess begann im 19. Jahrhundert mit einer allgemeinen Etablierung und Verbreitung der sogenannten „Uji-Methode“ der Teeherstellung, einer besonderen Technik des Rollens der gedämpften Blätter, die erstmals von Nagatani Sôen im Jahre 1738 entwickelt wurde (es gab übrigens auch vor Nagatani Sôen bereits gedämpfte und gerollte Tees nach anderen Verfahren).
Diese Technik wurde jedoch noch einmal entscheidend in der Mitte des 19. Jahrhunderts in Shizuoka weiterentwickelt, vor allem um der steigenden Export-Nachfrage, insbesondere in die USA, nachkommen zu können.
Die bis dato von Hand ausgeführte Sencha-Herstellung wird also in der zweiten Hälfte des 19. und in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts nun von Maschinen mit außergewöhnlichem Erfolg und Effizienz übernommen.
Und dies ist somit eine weitere besondere Eigenschaft des japanischen Tees, denn die Mechanisierung der Herstellung ist weltweit unerreicht und übertrifft überdies die Qualität der Handarbeit.
Sencha
Im Jahr 2019 betrug der Anteil von Sencha an der japanischen Rohteeproduktion 53%. Diese Zahl mag niedrig erscheinen und ist auch zu relativieren, da es sich hier um den Anteil an der Gesamtproduktion handelt, d.h. alle Ernten zusammengenommen, einschließlich Low-End-Banchas, die teilweise zu Hôji-cha verarbeitet werden oder für Flaschenerzeugnisse bestimmt ist. Betrachtet man hingegen nur die Frühjahrsernten (erste Ernten, jap. ichibancha), aus denen der Qualitätstee hergestellt wird, dann stellt der Sencha einen viel höheren Anteil dar, nämlich etwa Dreiviertel aller Tees. Deshalb bietet er sich nicht nur als idealen Ausgangspunkt für die eigene Erkundungsreise an, sondern ist darüber hinaus, dank seiner besonderen Vielfältigkeit und seines Facettenreichtums, die Sorte, mit der man seine Kenntnisse über japanische Tees immer weiter vertiefen kann.
Nach der Ernte werden die Blätter zunächst gedämpft, bevor sie gerollt, geknetet und erhitzt werden, um sie zu trocknen. Es gibt vier Hauptstufen des Knetens oder Rollens: 1. Primärkneten (Blätter werden gerollt und erwärmt), 2. Rollen (einfaches kreisförmiges Kneten, ohne Wärme), 3. Sekundärkneten (Blätter werden gerollt und erwärmt), 4. Abschlusskneten (Blätter werden gewalzt und erwärmt).
Als nächstes werden die Blätter einfach durch Hitze getrocknet, um einen rohen Tee (Aracha genannt) zu erhalten, in dem noch 5% Restfeuchtigkeit vorhanden ist. Dieser Rohtee wird im nächsten Schritt sortiert, um die Stängel und das Pulver zu entfernen und die unterschiedlich großen Blätter zu gruppieren, bevor er dann eine abschließende Trocknungs- oder Röstphase durchläuft, auf Japanisch hi-ire genannt, um den Feuchtigkeitsgehalt auf etwa 3% zu senken. Dies ist der Zeitpunkt, an dem der Tee nun zu einem fertigen Erzeugnis wird und von daher ist diese Verfeinerungsphase unerlässlich.
Heute unterscheidet man zwei Haupttypen von Sencha: den „Futsûmushi-Sencha“, ein Sencha mit normaler (oder Standard-) Dämpfung, und den „Fukamushi-Sencha“, ein Sencha mit einer langen Dämpfung, die eine neuere Entwicklung aus den 1950er Jahren ist. Manchmal werden die Begriffe „Asamushi" (leichte Dämpfung, ein Begriff, der das gleiche meint wie „Futsûmushi"), „Chûmushi" (Zwischendämpfung) oder „Tokumushi" (Spezialdämpfung) verwendet, aber in Ermangelung klar definierter Standards sprechen die maßgeblichen Stellen wie der Zentralverband Japanischer Tees nur noch von „Futsûmushi-Sencha“ und „Fukamushi-Sencha“. Obwohl es viele Nuancen gibt, kann man sagen, dass erstgenannter einen Tee mit ganzen Blättern und einem klaren und durchsichtigen Aufguss hervorbringt, während letzterer mehr gebrochene Blätter hat und einen trüben und bisweilen undurchsichtig-opaken Aufguss ergibt.
Beschattung?
Eigentlich gilt Sencha als vollsonniger Tee, d.h. dessen Plantagen beim Anbau nicht beschattet werden. In Wirklichkeit wird jedoch ein sehr großer Teil des Sencha heutzutage mehr oder weniger lange vor der Ernte beschattet, um die Nachfrage nach Tees mit mehr Umami und einer grüneren Farbe zu bedienen (wir werden diesen Effekt beim Gyokuro näher erklären).
Nicht zuletzt trägt auch die große Vielfalt der Cultivare (was wir bei Weinen als die Rebsorte bezeichnen würden) zum aromatischen Reichtum dieser großen Kategorie bei, welche die Senchas darstellen.
Abschließend sollte ebenso erwähnt werden, dass Sencha unter ein- und derselben Bezeichnung, Tees mit teils komplett unterschiedlichen Aromen beinhaltet und dabei ein sehr breites Qualitätsspektrum, von einfachsten bis hin zu absoluten Spitzentees umfasst.
Gyokuro
Gyokuro wird oft als der japanische Luxustee angesehen. Diese Darstellungsweise ist jedoch nicht so ganz zutreffend, weil es schon einmal zum einen eine ziemlich große Bandbreite an Gyokuros gibt und zum anderen, weil sie suggeriert, dass es sich um einen höherwertigen Tee im Vergleich zum Sencha handeln würde. Dies ist jedoch nicht der Fall. Es handelt sich einfach um eine ganz andere Art von Tee und vor allem um eine ganz andere Art der Zubereitung, so dass Sencha und Gyokuro nicht anhand von einer Qualitäts-Skala miteinander verglichen werden sollten.
Die Besonderheit des Gyokuro ist, dass er aus Plantagen stammt, wo er lange beschattetet wurde. Die Teepflanzen werden mindestens 20 Tage vor dem vorgesehenen Erntetag beschattet, manchmal sogar mehr als 40 Tage. Die Verarbeitung nach der Ernte unterscheidet sich dann jedoch nicht mehr wesentlich von der des Senchas.
In diesem Zusammenhang sollte man wissen, dass es verschiedene Methoden der Beschattung und der Ernte gibt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Qualität des fertigen Endprodukts haben.
● Eine Plantage des Typs Shizen-Shitate, Beschattung unter einem Überdach, handgepflückt
Dieses Herstellungsverfahren ist das ursprünglichste, das authentischste und auch das qualitativ hochwertigste.
Die Teesträucher werden hier nicht wie bei einer herkömmlichen Plantage beschnitten. Das bedeutet wiederum, dass sie von Hand geerntet werden müssen. Allerdings werden die Teesträucher nach der Ernte dann sehr kurz heruntergeschnitten und ein Jahr lang zum Nachwachsen ruhig stehen gelassen. Aus diesem Grund ist nur eine Ernte pro Jahr möglich. Des Weiteren wird diese Plantagenform unter einem Überdach (Tanashita) beschattet, d.h. unter einer Konstruktion, die eine freie Luftzirkulation unter der Abdeckung ermöglicht. Die Abdeckung wird entweder aus einem natürlichen Material (Schilfrohr und Stroh) oder aus einer synthetischen Faser hergestellt und kann ein-, zwei- oder dreilagig sein, wodurch die Intensität der Beschattung reguliert werden kann.
● herkömmliche Plantage
Für eine standardmäßig geschnittene Plantage sind mehrere Varianten möglich.
・Handernte / Beschattung unter einem Überdach
・Maschinelle Ernte / Beschattung unter einem Überdach
・Maschinelle Ernte / direkte Beschattung (d.h. Teepflanzen, die direkt mit einer Kunststofffaser-Abdeckung bedeckt sind, die keine Zirkulation darunter zulässt, so wie es auch bei einer Reihe von Senchas der Fall ist)
Warum werden Teepflanzen überhaupt beschattet?
Nun, weil dies Teeblätter ergibt, die sehr reich an Umami sind.
Die Teepflanze zieht über die Wurzeln die Azoverbindungen aus dem Boden, die wiederum die für das Umami verantwortlichen Aminosäuren bilden. Diese Aminosäuren werden in den Blättern durch Photosynthese in adstringierende Polyphenole umgewandelt. Die Beschattung jedoch ermöglicht es, diesen Prozess zu verlangsamen und somit mehr Umami zu erhalten.
Die Beschattung verlangsamt ferner den Abbau von Koffein, weshalb beschattete Tees einen höheren Koffeingehalt aufweisen.
Um das sehr kräftige Umami noch weiter herauszubringen, wird der fertige Gyokuros auf eine sehr konzentrierte Art und Weise zubereitet, d.h. mit einer großen Teemenge und sehr wenig Wasser. Die Aufgusstemperatur ist dabei nur handwarm, um die Diffusion der adstringierenden Polyphenole ins Wasser noch weiter zu begrenzen. Er ist eine Art japanischer Tee-Espresso.
Gyokuro wird traditionell in Kyoto (Uji-Tee) angebaut, allerdings ist inzwischen die Präfektur Fukuoka mit ihrem Yame-Gyokuro marktführend geworden, wobei der Stil hier ein etwas anderer ist. Außerdem findet man noch, wenn auch viel seltener, Gyokuro aus Asahina in Shizuoka.
Tencha / Matcha
Der geerntete Tee, der quasi als Rohstoff dient, wird Tencha genannt. Einmal gemahlen, wird er dann als Matcha bezeichnet.
Obwohl er in Japan kein Tee des alltäglichen Konsums darstellt, so ist er doch die einzige Sorte, deren Herstellung seit den 1990er Jahren deutlich gestiegen ist. Allerdings ist dieser Anstieg auf die Erzeugung von mittelmäßigen oder geringeren Qualitäten zurückzuführen, die für Backwaren oder Milchgetränke bestimmt ist.
Denn authentischer Matcha stammt eigentlich von Shizen-Shitate-Plantagen (siehe Erklärung oben im Absatz über Gyokuro), der in einem Tencha-Ro-Ofen getrocknet, nicht gewalzt und mit Stein-Mühlwerken gemahlen wird. Auch wenn es dazu keine genauen Statistiken gibt, so schätzt man, dass diese originale Herstellungsart von Matcha nur 3% des weltweit als japanischen Matcha verkauften Tees ausmacht.
Bei den Erntemethoden gibt es all die verschiedenen Variationen, die wir schon für den Gyokuro gesehen haben, wobei zusätzlich noch Tencha aus zweiter Ernte, oder noch schlimmer aus nicht einmal beschatteter Herbsternte, Akiten genannt, produziert werden.
Die Matchas der unteren Preisklassen werden zudem nicht mit Steinmühlen gemahlen, sondern mit Kugelmühlen aus Keramik, die in einer weniger feinen Mahlung resultieren.
Die Besonderheit der Tencha-Herstellung besteht darin, dass die Blätter nach der Dämpfung in einer Art großem Ziegelofen (Tencha-ro) getrocknet werden, ohne geknetet oder gerollt zu werden. Es gibt aber auch einfachere Öfen (kan.i-ro), die für billigere Produktionen verwendet werden.
In Japan sind keine definierten Qualitäts-Grade für Matcha bekannt, von daher existiert beispielsweise der „Ceremony-Grade" gar nicht, sondern ist nur eine Erfindung einiger westlicher Verkäufer. Fragen Sie also Ihren Händler lieber nach der Art des Anbaus, der Ernte, der Beschattung und ähnlichem für den Matcha, den er Ihnen anbietet.
Außerdem wird für Matcha wie für Gyokuro der Ausdruck „Neuer Tee“ oder Shincha eigentlich nicht verwendet, da es als notwendig betrachtet wird, dass sie noch weiter reifen, bevor sie konsumiert werden können. Der jeweilige Jahrgang dieser Tees wird daher in der Regel erst ab Herbst in den Verkauf gebracht. Dabei wird Matcha vorher in ungemahlener Form als Tencha gelagert. In Uji vertreten einige sogar die Auffassung, dass ein Jahr Reifezeit notwendig ist.
Man sagt, dass Matcha im Jahr 1191 von dem Mönch Eisai aus China eingeführt wurde. Zu dieser Zeit wurden die Plantagen noch nicht beschattet, diese Praxis soll erst im 16. Jahrhundert entstanden sein.
Tencha wird traditionell in Kyôto (Uji-Tee) hergestellt, aber der Aichi-Distrikt mit dem Gebiet um Nishio hat sich zu einem sehr wichtigen Anbaugebiet entwickelt, das sich allerdings vor allem auf industriellen Matcha konzentriert.
Kabuse-cha
Kabuse-cha ist, wie der Name auf Japanisch schon verrät, ein " abgedeckter" Grüntee, d.h. er wurde beschattet. Er wird meistens direkt beschattet und die Dauer ist dabei kürzer als bei einem Gyokuro, aber länger als bei den meisten beschatteten Senchas, in der Regel etwa 2 Wochen. Man findet ihn hauptsächlich in Kyoto und Mie.
Die Herstellungsmethode ist ansonsten dieselbe wie für den Sencha.
Tamaryokucha (gedämpft)
Obwohl Tamaryokucha unter Teeliebhabern im Westen ein relativ bekannter Name ist, handelt es sich in Japan tatsächlich um eine sehr kleine Teegattung.
Manchmal auch Guricha genannt, bezieht sich Tamaryokucha meist auf Mushisei-Tamaryokucha, einen gedämpften Grüntee, im Gegensatz zu dem im nächsten Abschnitt besprochenen Kamairi-sei Tamaryokucha, der nicht gedämpft, sondern wie chinesische Grüntees durch direkten Kontakt mit einer heißen Oberfläche geröstet wird. Es handelt sich hier also auch um einen gedämpften Grüntee, jedoch unterscheidet er sich in der Methode des Knetens/Rollens und des Trocknens etwas von Senchas. Denn die letzte Phase des Knetens oder Walzens wird nicht durchgeführt, und daher haben die Blätter nicht die charakteristische Nadelform eines Senchas. Um dies zu kompensieren, werden zwei Trocknungsphasen ohne Walzen hinzugefügt.
Diese Herstellungsart wurde übrigens in den 1920er Jahren entwickelt, mit dem Ziel einen Tee zu gewinnen, der dem Erscheinungsbild von Kama-iri cha, d.h. chinesischen Grüntees, ähnlich ist, dabei aber gleichzeitig die bestehende Infrastruktur für gedämpften Tee nutzt. Damals wurde nämlich ein Tee benötigt, der mit chinesischem Grüntee gemischt werden konnte, um ihn über die Sowjetunion in den Nahen Osten zu exportieren.
Il est aujourd’hui essentiellement produit à Kyûshû dans les départements de Saga à Ureshino, de Nagasaki à Sonogi et de Kumamoto.
Heute wird er vorwiegend in Kyûshû in den Bezirken Saga in Ureshino, Nagasaki in Sonogi und Kumamoto hergestellt.
Üblicherweise wird er gegenwärtig mit dem Fukamushi-Verfahren gedämpft und in einer beschatteten Anbauweise kultiviert. Überdies verleiht ihm seine Verarbeitungsmethode, die mehr Wert auf die Hitzeeinwirkung legt, oft einen wärmeren und süßeren Geschmack, was ihn, zusammen mit seinem Umami aus der Beschattung, zu einem sehr zugänglichen Tee macht.
Kama-Iri Cha
Diese letzte Art von grünem Tee ist sogar älter als Sencha, da die Methode, die Oxidation der frischen Blätter durch Erhitzen auf einer heißen Oberfläche zu stoppen und anschließendes Trocknen durch Kneten, bereits im 17. Jahrhundert aus China eingeführt wurde. Heute ist diese Form in Japan nur noch sehr selten anzutreffen, da sie im 19. Jahrhundert weitgehend durch das Dämpfen ersetzt wurde.
Sein offizieller Name ist Kamairi-Sei Tamaryokucha, wegen der Form der trockenen Blätter, die der des gedämpften Tamaryokucha sehr ähnlich sind.
Er wird hauptsächlich in Kyûshû, in den Provinzen Miyazaki und Kumamoto hergestellt.
Eine Tee-Sorte mit wenig Adstringenz, sehr duftend mit ausgeprägten Räuchernoten. Selbst in Japan sehr wenig bekannt, ist sie dennoch sehr interessant und leicht zugänglich.
Schwarze Tees und Oolong
So überraschend es klingen mag, wird in Japan bereits seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schwarzer Tee hergestellt. Als sich die Tee-Branche mit dem Export von Sencha in die westlichen Länder rasant entwickelte, beschloss die Regierung, auch eine Schwarztee-Produktion für ausländische Märkte zu schaffen. Doch trotz aller Bemühungen war dieses Unterfangen nie besonders von Erfolg gekrönt und die Schwarzteeherstellung verschwand in den frühen 1970er Jahren fast vollständig.
Seine Erzeugung wurde aber in den 1980er Jahren von einer Handvoll leidenschaftlicher Teeanbauer allmählich wiederaufgenommen und erfährt seit den 2010er Jahren einen echten Zuwachs an Interesse und vor allem eine deutliche Qualitätsverbesserung. Obwohl sie im Vergleich zur gesamten Teeproduktion in Japan immer noch verschwindend gering ist, wird sie immer attraktiver, und wir von Thés du Japon bemühen uns, das Beste davon zu präsentieren.
Aus der Zeit, als die Regierung die Weiterentwicklung des Schwarztees förderte, haben wir noch eine Reihe von Sorten, wie z.B. Benihomare für die älteste, die aus indischen Teesamen gezogen wurde und von Tada Motokichi 1878 nach Japan gebracht wurde. Oder Benihikari und Benifûki, die die neuesten und weit verbreitetsten darstellen.
Darüber hinaus gibt es aber auch großartige Schwarztees aus Grüntee-Sorten, wie z.B. Izumi, Kôshun, etc.
Heutzutage wird er entweder als Wa-Kôcha (wörtlich: "japanischer Schwarztee") oder Ji-Kôcha (wörtlich: "lokaler Schwarztee") bezeichnet.
Am Ende sei noch darauf hingewiesen, dass schwarzer Tee aus den gleichen Blättern wie grüner Tee hergestellt wird, lediglich das Verfahren unterscheidet sich. Die Blätter werden laut offizieller Bezeichnung „fermentiert“, aber eigentlich handelt es sich bei diesem Vorgang nicht um eine Fermentation, sondern vielmehr um eine Oxidation. Nach dem Pflücken lässt man die Blätter zunächst Anwelken und danach werden sie geknetet, bevor man sie oxidieren lässt. Zum Schluss werden sie erhitzt, um die Oxidation zu beenden und sie zu trocknen (daran anschließend kann es noch weitere Röstphasen geben).
Es gibt zudem eine Fertigung von Oolong-Tees, die in ihrem Umfang nochmal bescheidener ist als Schwarztee und für die es auch noch weiterer Fortschritte bedarf.
Die Banchas
Ich schreibe "die" und nicht "der" Bancha, weil sich dieser Begriff auf mehrere und unterschiedliche Gegebenheiten bezieht. Erstens gibt es die häufigste Verwendung dieses Wortes, um groben Sencha aus späten Ernten zu bezeichnen. Das können sowohl Herbsternten (Shûtô-Bancha) als auch späte, dicke Blätter sein, die nach der ersten Ernte geerntet werden (manchmal Kari-Ban genannt).
Dieser Begriff bezeichnet aber auch manchmal eine Vielzahl von traditionellen regionalen Tees mit sehr unterschiedlichen Herstellungsmethoden (einfach gekochte und in der Sonne getrocknete Blätter, fermentierte Blätter usw.). Mittlerweile sehr selten geworden, erfreuten sie sich früher jedoch einer größeren Popularität als Waren des täglichen Lebens, die eng mit den Mahlzeiten verbunden waren. Bis in die Nachkriegszeit war es diese Art von Tee, und nicht etwa Sencha und noch weniger Matcha, die der durchschnittliche Japaner konsumierte. Beispielsweise Kyô-Bancha, Mimasaka Bancha, Goishicha u.a. seien in diesem Zusammenhang erwähnt.
Andere Arten von Tee
Die nachfolgend vorgestellten Tees sind keine Gattungen im Sinne der oben vorgestellten, da sie aus einer Umwandlung der zuvor genannten Tees stammen.
● Hôji-cha
Das Ergebnis einer Hochtemperatur-Röstung eines grünen Tees, im Allgemeinen von eher geringer Qualität.
● Genmaicha
Die Zugabe von geröstetem Reis zu einem grünen Tee, in der Regel ein einfacher Sencha oder Bancha.
● Kuki-cha
Kuki bezieht sich auf die Teestängel, die während der Verarbeitungsphase eines Sencha oder anderen Tees aussortiert werden. Diese Stängel können dann als Kukicha verkauft oder als Rohmaterial zur Herstellung von Hôji-cha verwendet werden.
Der Kukicha wird als „Demono" (Produkt aus einer Aussortierung) bezeichnet.
● Kona-cha
Ein weiterer Demono ist das bei der Verarbeitung von frischem Aracha-Tee aussortierte Staubpulver.
● Me-cha
Ein weiterer Demono sind die kleinen Reste von Knospen, die bei der Verarbeitung von frischem Aracha-Tee aussortiert werden.
● Funmatsu-cha
Dieser Begriff bezieht sich auf grünen Tee, der zu einem Pulver gemahlen wurde, jedoch nicht um daraus Matcha zu machen. Das Rohmaterial ist dann ein sehr minderwertiger Tee und auch die Mahlverfahren unterscheiden sich sehr (gefriergetrocknet, etc.). Dies ist normalerweise das, was Sie als Instant-Grüntee finden, der z.B. Konacha in den meisten Sushi-Restaurants ersetzt hat.